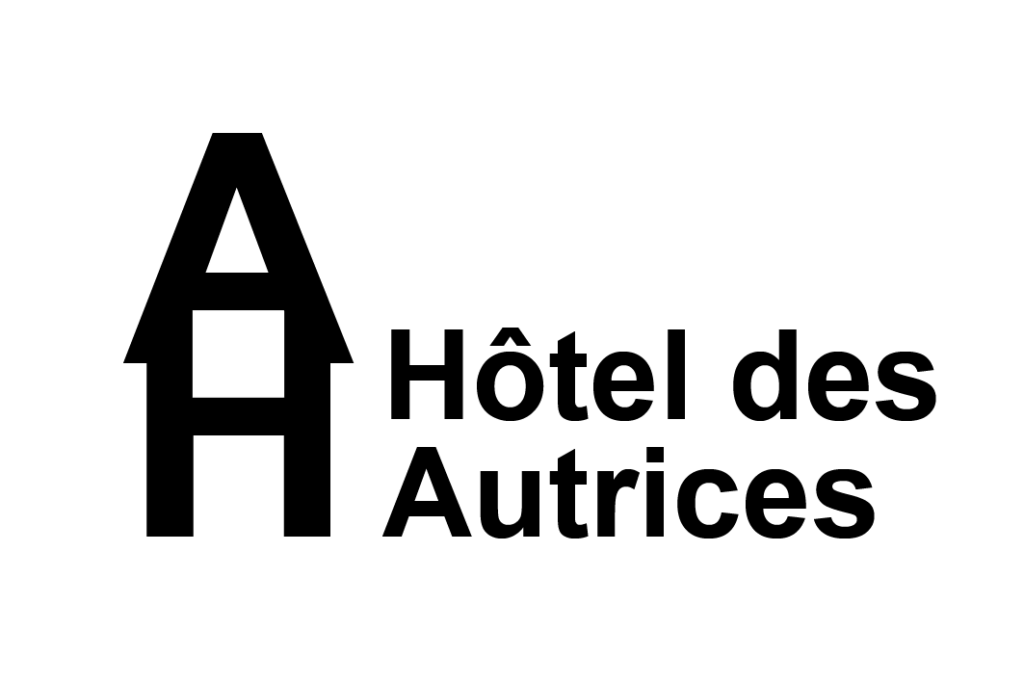Maike Wetzel
2021D014
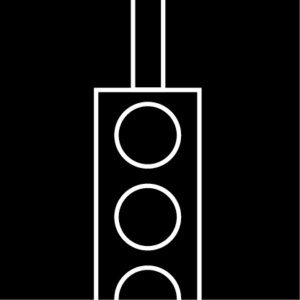
„Arbeit“, sagte ihre Mutter, „das ist etwas, worauf du dich freuen kannst.“ Die Frau schaute nicht auf, sondern blieb in ihrer Geierhaltung über den Bildschirm gebeugt. Sie schaltete um, schaltete weg, schaltete verschiedene Kanäle stumm. Ihre Mutter murmelte weiter im Hintergrund ihres Bewusstseins. „Denn Arbeit wird belohnt. Natürlich nicht, was du für deine Familie, für Bedürftige oder für dich machst. Das ist keine richtige Arbeit. Fürsorge nennt man das; ein Lebenswerk im besten Fall. Richtige Arbeit wird bezahlt. Und zwar angemessen. Der Lohn sagt dir, ob es wichtig ist, was du machst. Manchmal wird der Lohn nicht in Geld gezahlt. Du bist so eine, die stattdessen nach Ruhm und Liebe giert.“ Die Frau wollte zurückfragen: Aber was ist Liebe? Was ist Arbeit? Was ist Zeit? Was ist Lohn? In einem Bilderbuch würde es einen gemalten Gegenstand für jeden dieser Begriffe geben. Für die Liebe ein rotes Herzsymbol und für die Arbeit waren es mal Hammer und Sichel. Ihre Mutter sprach in ihrem Inneren als eine Stimme, die immer zu ihr sprechen würde. Eine Stimme, deren Worte die Frau verachtete, deren Abgründe sie so gut kannte und der sie doch immer lauschte. Die Stimme ihrer Mutter war schrill und zärtlich, streng und sehnsüchtig. Die Stimme ihrer Mutter klang wie ihre eigene.
Diese Frau klickte, um ihr Geld zu verdienen. Es war so einfach und praktisch, sie konnte dabei Musik und Radio hören, sogar Filme gucken. Sie drückte mit einer Hand auf die Computer-Maus oder sie strich mit dem Finger über ihr Smartphone, wählte verschiedene Optionen und bekam dafür Centbeträge überwiesen. Im Hintergrund schlief ihr Baby, sie lebten allein in einer Zweizimmerwohnung. So testete sie zuhause am Rechner Fragebögen für Versicherungen oder andere Firmen. Manchmal beantwortete sie auch einfach Fragen zu Puzzle-Bildern. „Wie viele Busse, wie viele Ampeln, wie viele Motorräder sehen Sie?“ Ein anderes Mal verfasste oder korrigierte sie Produktbeschreibungen. Ein paar Mal übersetzte sie diese Texte auch ins Englische. Dann sollte sie sich Schlagworte zu Bildern überlegen, die für Aufmerksamkeit im Netz sorgen würden. Danach kontrollierte sie, ob die Cover von Musikalben jugendfrei waren. Häufig testete sie auch Apps. Dann kaufte sie zum Beispiel Tickets oder anderes zur Probe, mietete Ruderboote, eröffnete ein Konto. Nichts davon war echt. All die Kleinarbeit im Internet, die noch kein Computerprogramm erledigen konnte, die übernahm diese Frau oder einer ihrer Kollegen. Sie bekam dafür keinen mehrseitigen Arbeitsvertrag. Sie musste nicht einmal etwas unterschreiben. Sie musste nur klicken. Sie war eine Minutenlöhnerin, eine Crowdworkerin, die die anderen im Schwarm nie zu Gesicht bekam. Selbstständig. Sie arbeitete selbst. Sie arbeitete ständig. Sie registrierte sich bei einer der vielen Plattformen mit kuriosen Namen, wie dem „mechanischen Türken“, dessen Bezeichnung von einer Schachmaschine aus der Zeit der Kaiserin Maria Theresia stammte. Diese Maschine schlug damals alle, die gegen sie antraten. Tatsächlich handelte es sich um Betrug: Ein genialer Schachspieler versteckte sich in einer Kiste unter der Tischplatte. Eine Plattform für Klickarbeit als „mechanischen Türken“ zu bezeichnen war also ein Witz über unsichtbare Sklavenarbeit. Alle, die unter diesem Namen anheuerten, sollten sich offenbar mit möglichst viel Selbstironie von sich selbst und ihrer Tätigkeit distanzieren. Teilweise regulierten die Frau und ihre unsichtbaren Kollegen selbst ihren Lohn, indem sie ihre Dienstleistungen auf Auktionen feilboten. Für jede der Mini-Aufgaben, die die Frau dann ergatterte und ausführte, erhielt sie ein paar Cent. Kurz vor der Geburt ihrer Tochter hatte sie mit dem Klicken angefangen. Zuerst steigerte sich ihr Verdienst, Cent für Cent. Knapp vier Euro in der Stunde schaffte sie jetzt, wenn sie sich konzentrierte. Doch sie schweifte ständig ab. Das Kind schrie, das Kind störte und sie selbst fiel und fiel und kam doch niemals auf dem Boden an. Sie litt unter dem Gefühl, zu ersticken. Sie riss die Fenster auf. Doch die Luftleere blieb. Schal, abgestanden, öde. Sie hängte ihren Kopf aus dem Fenster, schnappte nach Luft. In ihrer Kehle kratzte jeder Atemzug. Die Nachbarin klopfte und wollte ein Paket abholen. Die Frau öffnete ihr nicht. Sie brütete gerade über der Beschreibung einer Handtasche. Sie benötigte zu viel Zeit dafür und der virtuelle Aufseher war trotzdem nicht zufrieden: „Zu lang. Zu ähnlich zu Modell 103. Zu viele sachliche Fehler. Bitte überarbeiten Sie sie noch einmal!“ Die Frau begann zum fünften Mal von vorn. Ihre Haare waren strähnig. Sie klickte und klickte und dazwischen chattete sie mit einem von hundert Kandidaten von der Dating-Plattform. Sie hatte zwanzig verschiedene Fenster offen und hielt ihre Tochter vor sich auf der Tischplatte fest, um sie zu stillen, während sie klickte. Sie lag auf einem Handtuch. Das schien ihr zu reichen. Der Säugling saugte besser, als die Frau ihn stillen konnte. So kam es ihr vor. Ihre Tochter war ein Saug-Profi. Das Vakuum, das sie mit ihren Lippen erzeugte, zog die Brustwarze der Frau so stark an, dass sie vor Schmerz aufstöhnte. Dann strömte die Muttermilch, dieses angeblich perfekte, sterile und gegen Krankheiten schützende Lebensmittel aus der Frau in ihre Tochter. Lassen wir diese Frau für einen Moment allein. Es ist besser, beim Stillen nicht zu stören.
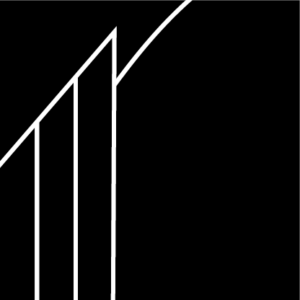
Die andere Frau wollte eigentlich schreiben, fand dafür aber keinen Raum. Sie besaß einen ausgezeichneten Uniabschluss und wenig mehr. Sie wollte nur kurz etwas Geld verdienen, sich ein Polster verschaffen, um dann in Ruhe nach einer Stelle suchen zu können, wo sie tun konnte, was ihr gefiel. Wo sie sich einsetzen konnte, Anerkennung erringen und sich selbst verwirklichen. Ihr gefiel der Ausdruck eigentlich nicht. Sie war doch schon echt, sie musste nicht mehr realisiert werden. Also wirklich. Sie zählte sich auf, was sie schon geschafft hatte. Als Erste in ihrer Familie einen Hochschulabschluss. Als Erste raus aus der Provinz. Sie wollte auch als Erste ans Ziel. Ins Glück. Das kleine Mädchen, das sie mal gewesen war, schaute hoch zum Himmel. An seiner Nasenspitze glänzte ein Tropfen. Sie setzte dieses Mädchen auf die Bank vor der Firma. Sie reichte ihm nicht mal ein Butterbrot. Sie sagte ihm, es solle die Wolken zählen, bis sie zurückkehre. Sie wusste genau, dass sie log. Sie wollte nicht zurückkehren. Sie wollte vorwärts. Hoch. Aufsteigen. Glänzen. Diese Firma war dabei nur eine Station. Eine Art Geld-Tankstelle, bevor es ernst werden würde für sie, bevor sie sich ganz einer anderen Art von Arbeit hingeben würde. Einer, die es wert war. Die Sinn stiftete und nicht nur Geld. Dieser Job bei dieser Firma hier würde sie nicht fordern. Die Firma sollte sie beschäftigen und sie dafür bezahlen. Mehr nicht. Die Firma wucherte. Am Rand der Stadt breiteten sich ihre Gebäude aus wie Wasseradern, in alle Richtungen. Schon lange bevor die Frau den Eingang fand, lief sie an den Mauern entlang, beschirmte ihre Augen, schaute an den Wänden hoch bis zu der scharfen Dachkante und fühlte den Schweiß ihre Wirbelsäule entlang rinnen. Die Wolken am leuchtend blauen Himmel zogen schnell wie im Zeitraffer vorbei.
In der Firma wartete niemand auf sie, stattdessen musste sie warten. Von Anfang an musste sie warten. Die Firma verfügte über ihre Zeit. Sie zeigte ihre Macht, indem sie ihre Zeit nichtig machte, sie zum Nichts erklärte. Die Frau saß auf dem fensterlosen Gang und schlug ein altes Buch aus ihrem Studium auf. „Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, daß er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man ‚historischen Materialismus‘ nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und häßlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen.“ Die Frau war zu nervös, um den Aufsatz von Walter Benjamin „Über den Begriff der Geschichte“ zu Ende zu lesen. Sie erinnerte sich, dass er später den Klassenkampf erwähnte und wie wichtig Zuversicht, Mut, Humor, List und Unentwegtheit in diesem Kampf seien. Die Frau legte das Buch zur Seite. Sie starrte an die Wand. Die anderen Anwärter, die neben ihr saßen, sah sie nicht an. Sie studierte die Gesichter und Körper der Angestellten, die vorübereilten, wehten, mit ihren Absätzen klackerten oder stampften. Ihre Zeit dehnte sich kaugummiartig, unvorhersehbar. Das Warten spannte sie an. Dennoch war die Leere von einem Augenblick auf den nächsten vorbei.
Eine Flügeltür öffnete sich. Mit einer Armlänge Abstand zueinander betraten die Frau und die übrigen Anwärter den Versammlungsraum und ließen sich auf den vereinzelt stehenden Stühlen nieder. Die Bühne war noch leer, die Stühle unbequem, der Raum lag im Halbdunkel. Plötzlich hechtete ein Mann auf die Bühne. Seine Schritte federten, als feuerten kleine Kanonen unter seinen Fersen ihn in die Höhe. Er grinste quer über sein kantiges, bräunlich glänzendes Nussknackergesicht. Sein Bizeps und die Oberschenkelmuskeln sprengten fast seine Bundfaltenhose und das hellblaue Hemd. Er nannte seinen Namen, den die Frau sofort wieder vergaß. Er duzte alle und erzählte fröhlich, wie er zu der Firma gekommen war Sein leichter Akzent verriet sich nur in der ungewöhnlichen Betonung einzelner Worte und der Häufigkeit, mit der er „Folgendes“ wiederholte. Zunächst sprach er von den Kleidern, die die Firma herstellte. Es handelte sich um Freizeitkleidung und Nachtwäsche, Kleider zum Wohlfühlen, Kleider für die Aus-Zeit, die weniger schmücken, sondern vor allem ein gutes, sicheres und gesundes Gefühl vermitteln sollten. Dann sprach er davon, wie hart umkämpft die Textilbranche sei und dass die Firma als eine der wenigen überhaupt noch in Deutschland produziere. Sie täte dies aus Überzeugung, für das Gemeinwohl. Nicht Macht, Marktanteile und Größe seien für das Handeln der Firma bestimmend, sondern Solidarität, Verantwortung für die Mitmenschen, Gerechtigkeit und Beständigkeit. Die Frau fragte sich, ob sie davon beeindruckt war. Bevor sie sich zwischen Skepsis und Begeisterung entscheiden konnte, sprach der Nussknacker weiter. Er erinnerte die Anwärter daran, dass das Nähen von Kleidern immer noch Handarbeit sei und dass ihre Firma im Gegensatz zu Konkurrenten nicht etwa Kinder in anderen Ländern schuften ließe. Stattdessen kämen sie, die neuen und die angestammten Arbeiter, in den Genuss einer smarten Fabrik. Mensch und Maschine ergänzten sich hier in Perfektion. Alles würde in Daten verwandelt – Mitarbeiter, Maschinen und Prozesse. Sie befänden sich im Stammwerk der Firma, doch tatsächlich existiere davon bald eine zweite Ausgabe – ein virtuelles Werk. Noch sei der digitale Zwilling der Fabrik nicht fertig. Sobald er errichtet sei, habe die Firma die Zukunft in der Hand. Denn die Künstliche Intelligenz könnte dann alles, was passieren werde, für das Unternehmen vorhersehen. Und sie wäre imstande die Zukunft im Interesse der Firma neu zu bestimmen. Schon jetzt könne die Künstliche Intelligenz prophezeien, wann Mitarbeiter das Unternehmen verlassen würden. Die Firma bilde deshalb schon vorher neue Kollegen aus, um diese Mitarbeiter zu ersetzen. Die Frau stellte sich vor, wie eine andere Frau genau in diesem Moment die Firma verließ und sie selbst ihren Kittel ausgehändigt bekommen würde.

Es gab auch eine Fahrerin in der schönen neuen Arbeitswelt. Sie fuhr gern Auto, sie liebte das Gefühl der Unabhängigkeit. Sie, ganz allein, in der metallischen Kapsel. Sie kaufte sich einen gebrauchten Wagen und zahlte ihn an, denn mit ihrem Lohn für die Kurierdienste würde sie ihn bestimmt bald ganz bezahlen können. Sie wurde ihre eigene Chefin und hatte eine kleine Frau im Handy, die ihr sagte, wie sie selbst noch besser werden konnte. Diese Frau hörte die kleine Frau bald nonstop in ihrem Ohr, selbst wenn das Handy weit weg war oder schwieg. Darin sah sie zunächst nur Vorteile. Sie und die anderne freien Fahrer stapelten so viele Pakete wie möglich in ihre Autos. Darunter waren auch Pakete der Kleiderfirma mit T-Shirts darin, die die Klickarbeiterin im Internet beschrieben hatte. Die Lieferkette verband die Frauen, ohne dass sie sich je zu Gesicht bekamen. Sie schauten auch nicht auf. Sie sahen nur den Bildschirm oder einen Ausschnitt der Straße, den die Windschutzscheibe rahmte. Nachdem die Fahrerin ihren Wagen beladen hatte, besuchte sie noch einmal die hellblaue Plastiktoilette. In dem bläulich getünchten Licht im Inneren wirkte ihre Haut schlumpffarben. Der strenge Geruch des Biozidzusatzes im Tank übertünchte den nach Urin und Fäkalien nicht vollkommen. Die Frau versuchte, sich möglichst geräuschlos im Stehen zu erleichtern. Draußen hörte sie Motoren starten. Als sie die Kabine wieder verließ, war der Parkplatz plötzlich leer bis auf ihren Wagen. Alle Kollegen waren bereits gestartet. Die Frau eilte zu ihrem Auto. Sie ließ die kleine Frau in ihrem Smartphone die Route programmieren. Dann startete sie. Gleich die erste Adresse lag in einer Einbahnstraße. Die kleine Frau wusste das offenbar nicht und lotste die Fahrerin vom falschen Ende aus hinein. Sie merkte es erst, als ihr ein anderer Wagen entgegenkam. Die Stoßstangen der Wagen berührten sich beinahe. Der andere Fahrer gestikulierte erbost und zwang die Frau, die Einbahnstraße im Rückwärtsgang wieder zu verlassen. Diesen Zeitverlust versuchte sie im Laufe des Tages wieder aufzuholen. Sie fuhr wie der Teufel, parkte in zweiter Reihe und klingelte immer wieder vergeblich an verschiedenen Türen. Sie bedrängte die Nachbarn, die Pakete anzunehmen. Sie ärgerte sich, wenn die Nachbarn sich weigerten. Sie zwängte zu große Sendungen in zu kleine Briefkästen. Sie schaffte es nicht, die vorgesehenen Liefertermine einzuhalten. Immer wieder wischte sie über ihr Handy, um den Bildschirm neu zu laden. Sie wollte sich neue Schichten sichern. Dazu musste sie schnell sein. Sie war erschöpft.
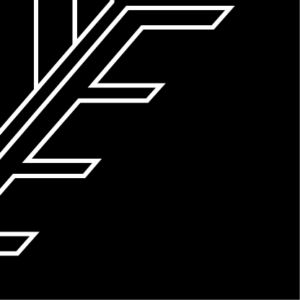
Auch in einem anderen, einem alteingesessenen Familienunternehmen arbeiteten fast ausschließlich Frauen, viele davon stammten aus Vietnam. Es war eine kleine Fabrik. Etliche Arbeiterinnen waren dort schon seit Jahren beschäftigt. Die Eltern der Chefin hatten den Betrieb aufgebaut. Die Chefin kannte die Namen der Kinder ihrer Mitarbeiterinnen, grüßte jede freundlich und erkundigte sich nach ihren Familien. Auch an diesem Tag scherzte sie mit ihren Angestellten, als sie die Fabrik betrat. Leise, kaum hörbar bat die Chefin die andere Frau, die Vorarbeiterin, in ihr Büro. Der Frau fiel auf, dass der Mann der Chefin im Wagen sitzenblieb. Das tat er sonst nie. Sie folgte der Chefin in das verglaste Büro und erzählte ihr, was bereits alles bewältigt war. Wie gut die neue Produktlinie funktionierte und dass sie persönlich das Rolltor repariert hatte, das geklemmt hatte. Doch es kam kein Lob. Die Chefin schien gar nicht zuzuhören. Die Vorarbeiterin redete weiter. Sie erwähnte, dass sie und eine andere Mitarbeiterin ihre Arbeitsstunden aufstocken wollten. Da endlich unterbrach sie die Chefin mit einem schlichten Satz: „Das wird nicht nötig sein.“ Die Vorarbeiterin schwieg und erwiderte dann: „Kommt Ihr Mann heute nicht in die Fabrik?“ Die Chefin seufzte und wandte sich ab. Während sie die Wand anschaute, erklärte sie, dass sie gezwungen sei, die Fabrik zu schließen. Die Konkurrenz aus Übersee sei einfach zu billig. Sie schafften es nicht mehr, das Geschäft umzukrempeln. Ihr Mann und sie hätten es zig Male versucht und auch jetzt verschiedene Lösungen erwogen. Doch die Fabrik sei nicht zu retten. Sie müssten schließen – schon in einem Monat. Die Vorarbeiterin blickte zum Fenster hinaus und fragte nochmal: „Kommt Ihr Mann heute nicht rein?“ Die Chefin kniff die Augen zusammen und erwiderte, ob ihre Vorarbeiterin etwa nicht verstanden habe, was sie gesagt hatte? Da schien die Frau zu sich zu kommen. Sie erwiderte, sie habe verstanden. Sie verstehe alles, natürlich. Die Chefin schien erleichtert. „Da bin ich froh. Sagst du es den anderen?“ Die Vorarbeiterin nickte und verließ das Büro.
Doch sie verkündete nichts. Stattdessen starrte sie lange eine Maschine im Leerlauf an. Dann stapelte sie mit einer jüngeren Kollegin Kartons im Lagerraum. Sie fuhren die Kisten mit einem Palettenwagen dorthin. Der Jüngeren fiel ihr Schweigen auf. Doch die Frau behauptete, alles sei in Ordnung. Sie nahmen wieder ihre Arbeit an den Maschinen auf. Auf einmal begann eine andere Kollegin zu husten. Sie konnte gar nicht mehr aufhören. Die Tränen rannen ihr über das Gesicht. Die Vorarbeiterin stoppte ihre Maschinen. Sie ging zu der Kranken, klopfte ihr auf den Rücken, reichte ihr ein Taschentuch und schickte sie nach Hause. Doch die Kranke weigerte sich. Sie erklärte, dass sie die Stunden brauche, um die Fahrschule ihres Sohnes zu bezahlen. Die Vorarbeiterin erklärte, sie solle trotzdem nach Hause gehen. Die andere nahm stur ihre Arbeit wieder auf, stanzte, stapelte, druckte. Die Vorarbeiterin sah ihr eine Weile zu. Dann stellte sie in der gesamten Halle den Strom ab. Alle Kolleginnen blickten hoch. Die Vorarbeiterin sagte der Kranken, sie solle nach Hause gehen. Es sei jetzt sowieso egal. Die anderen Kolleginnen horchten auf. Die Kranke verschränkte die Arme, sah die Vorarbeiterin herausfordernd an und wich nicht von ihrem Platz. Die Vorarbeiterin ärgerte das. Auch die anderen Kolleginnen erwarteten von ihr eine Reaktion. Dass sie durchgriff und die andere in die Schranken wies. Da sagte die Vorarbeiterin ihnen endlich die Wahrheit. Der Laden werde geschlossen, schon bald. Die anderen Arbeiterinnen starrten sie an. Sie standen weiter im Dunkeln. Raunend berieten sie, was jetzt zu tun sei, kamen aber zu keinem Schluss. Schließlich schalteten sie den Strom wieder an und setzten damit die Maschinen wieder in Gang. Sie arbeiteten weiter, als sei nichts geschehen, und verließen zum Feierabend die Fabrik. Als die Vorarbeiterin abends das Rolltor schloss, rollte eine leere Schnapsflasche darunter weg. Auf der Straße sah sie ein Mofa langsam Schlangenlinien fahren und dann am Bordstein umkippen. Die Fahrerin blieb liegen, obwohl sie sicher nicht schwer verletzt war.
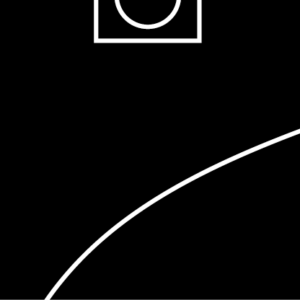
Die junge Mutter dagegen saß weiter vor ihrem Bildschirm. Sie durfte davorsitzen. Sie war nicht allein in der Steppe. Sie befand sich in der kuscheligen Hülle eines Mehrfamilienmietshauses. Sie lebte in Freiheit. Doch selbst wenn sie auf die Toilette gehen musste, nahm sie ihr Smartphone mit und klickte weiter. Das Kind schrie mal wieder. Schrie und schrie und nichts konnte es beruhigen. Nach einer Weile versuchte die Mutter, das Brüllen zu ignorieren. Dunkle Flecken breiteten sich auf ihrem Shirt aus. Die Milch floss, die Tränen des Kindes ließen ihre Brüste tropfen. Doch das Kind konnte nicht hungrig sein. Sie hatte es doch gerade erst gestillt. Oder war das schon länger her als drei Stunden? Nach einer Weile roch sie den ranzigen Gestank der getrockneten Milch. Das Kind schwieg. Erschrocken rannte sie zu seinem Bett und hielt einen Spiegel über seinen Mund. Er beschlug nicht. Sie lauschte auf den Atem des Kindes. Sie konnte nichts hören. Sie stupste es an. Es grunzte. Da sank sie erleichtert auf ihren Sitzball zurück und wiegte sich tröstend. Aus den Lautsprechern ihres Rechners tönte ein englisches Gute-Nacht-Lied. „Twinkle, twinkle little star / How I wonder what you are …“ In dem Film zeigte ein reicher junger Mann mit dem Finger auf drei gewöhnliche Menschen. Sie waren die Gewinner eines Wettbewerbs, den er ausgelobt hatte. Der Film gehörte zu der begleitenden Kampagne. Der junge Mann wollte ins All reisen und diese drei Unbekannten durften ihn begleiten. Der Reiche wollte nicht nur die Sterne aus einer neuen Perspektive bewundern. Er wollte mit Hilfe der erzeugten Aufmerksamkeit für die Reise hundert Millionen Dollar an Spenden sammeln, um krebskranke Kinder zu retten. Als seine Gäste begleiteten ihn schließlich eine junge Arzthelferin, ein Ingenieur und eine Geologin. Sie flogen ganz allein in den Weltraum. Der Frau vor dem Computer stiegen Tränen der Rührung in die Augen, als sie all das vor ihrem inneren Auge sah: die vom Tod bedrohten Kinder, die unendliche Weite des Alls und eine Gruppe von Menschen wie sie selbst, ohne Astronautenausbildung, die eine Rakete bestiegen. Die Frau ärgerte sich über ihre Sentimentalität. Das erste Abendessen für die je zwei Männer und Frauen an Bord bestand aus kalter Pizza. In den Schränken der Raumkapsel lagerten aber auch Betäubungsmittel und Kabelbinder. Falls einer der Passagiere zur Gefahr für sich selbst oder die anderen werden sollte.
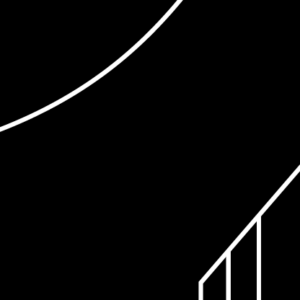
Die Frau in der Kleiderfabrik wartete inzwischen in der Kantine darauf, dass sie abgeholt würde. Sie lernte die anderen Anwärter für den Job kennen. Sie tauschten Namen und Funktionen aus. Die Frau sagte, dass sie gerade ihr Studium abgeschlossen habe. Die anderen fragten, was sie in der Fertigung suchte. Sie zähle doch bestimmt zu den Führungskräften. Die Frau fühlte sich geschmeichelt, tat aber cool. Sie zuckte mit den Achseln und vermutete, jeder käme mal dran. Das gehöre dazu. Der spätere Supermarktleiter müsse auch mal Konserven stapeln. Um zu wissen, wie sich Prozesse gestalten, wie sie sich beschleunigen lassen. Die anderen nickten verständnisvoll. Fast glaubte die Frau sich selbst. Sie schaute sich wieder nach jemandem um, der ihr verlässlich Auskunft geben könnte. Doch niemand erschien ihr dazu befugt. Sie suchte hier einen Überbrückungsjob, um ihren Umzug und die Renovierung der Wohnung zu bezahlen. Aber sie wollte dennoch lieber ins Büro als in die zugige Fertigungshalle. Der nächste Kollege stellte ihr exakt dieselben Fragen, die sie gerade bereits beantwortet hatte. Sie beantwortet sie gewissenhaft mit genau denselben Sätzen, nur ihre Betonung wich leicht ab.
Zur Einweisung wanderten die Frau und einige der anderen Anwärter durch die Fabrik. Sie bewunderten die riesigen, rotierenden Großrundstrickmaschinen, die die Stoffe herstellten, anschließend wurden die Bahnen in verschiedenen Wasch- und Bleichbädern veredelt und dann vollautomatisch zugeschnitten. Sie betraten nun die Näherei. Die Nähmaschinen standen dicht an dicht. Der Nussknacker wies die Frau an, sich versuchsweise an einem der Arbeitsplätze niederzulassen. Die Frau wollte widersprechen. Sie fragte sich, was die Anweisung bedeuten sollte. Sie war sicher, dass ein Versehen vorlag. Sie wollte nicht in die Fertigung. Sie passte nicht hierher. Sie wollte am Computer sitzen und Dinge bewegen, abarbeiten, Haken dran und weg. Doch während sie überlegte, was sie sagen sollte, drängte sie der Nussknacker, endlich loszulegen. Also setzte sie sich. Er platzierte ein Tablet an einer schwebenden Halterung über der Nähmaschine. „Wir denken hier nicht mehr in Abteilungen, sondern in Aufgaben. Hier macht niemand stunden- oder tagelang dieselbe Handbewegung. Nein! Unsere Mitarbeiter wechseln im Laufe eines Tages zwischen mehreren Aufgaben an verschiedenen Kleidungsstücken hin und her. Das ist anspruchsvoll, beschleunigt aber auf die Dauer alles. Das Geheimnis steckt in diesen Tablets. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen Ärmel hier geliefert bekommst, was fällt dir auf?“ Die Frau bemerkte, dass die Naht schief war. Der Nussknacker lobte sie und zeigte ihr, wo sie den Fehler auf dem Tablet vermerken sollte. „Diese Fehlermeldung schickst du an den Kollegen, der dafür zuständig war. So verbessern wir uns gegenseitig ständig. Und der Kollege kann dann mit Hilfe unseres Mixed-Reality-Games trainieren, wie er den Fehler vermeidet. So. Auf die Plätze – fertig – los!“ Die Frau öffnete den Mund, um zu sagen, dass sie keine Näherin sei, dass sie doch gar nicht hierhergehörte, aber der Nussknacker schaute mahnend auf seine Uhr. Da legte sie los. Und wurde zum Nähroboter, zur Tackermaschine. Sie dachte an die Sätze des Nussknackergesichts: „Die Maschinen sollen menschlicher und die Menschen maschineller werden. Dann kommen wir voran.“ Sie war selbst überrascht von ihrem Tempo, der Fraglosigkeit, den flinken Pirouetten. Der Nussknacker machte sich Notizen.

Das Kind der Klickarbeiterin schlief noch immer. Sie hoffte, es würde durchhalten bis nach ihrem Date. Sie schminkte sich und zog ein Top mit weitem Brustausschnitt über ihrer Jogginghose an. Sie lächelte sich selbst auf dem Bildschirm zu und erzählte dem Bärtigen, der einigermaßen rechtzeitig in einem anderen Fenster auftauchte, dass sie nicht allein lebte. Das stimmte ja auch. Als er fragte, ob sie in einer Wohngemeinschaft lebe, nickte sie zustimmend. Sein Hintergrund war gemalt. Er hatte sich in ein komplett weißes Atelier gesetzt. Sie fragte ihn spöttisch, ob es bei ihm unordentlich sei. Er gab das Chaos sofort zu und sie befürchtete nun weit Schlimmeres in seinem Zimmer – Leichenberge oder eine komatöse Mutter etwa. In der Selbstansicht kontrollierte die Frau fortwährend ihren eigenen Gesichtsausdruck. Sie zwang ihre hängenden Mundwinkel nach oben. Sie hätte für eine schmeichelnde Beleuchtung sorgen sollen. Dafür war es nun zu spät. Der Bärtige erkundigte sich nach ihrem Beruf. Sie sei in der Software-Branche, sagte sie leichthin. Auch das war nicht gelogen, klang aber so langweilig, dass niemand nachfragte. Das letzte Mal war sie Erzieherin gewesen. Das hatte viel zu viele Fragen provoziert. Alle Männer hatten offenbar genaue Vorstellungen von der Arbeit in Kindergärten. Und die Frau wollte eigentlich nur wissen, ob der Typ auf sie ansprang. Doch die Männer kamen eigentlich nie aus der Deckung oder wenn, dann gleich mit Nacktbildern. Der Bärtige hatte noch keins geschickt. Dafür war die Frau ihm dankbar. Sie nippte an ihrem Weinglas und merkte, dass sie nachschenken musste. Das füllte die Gesprächspause. Im Hintergrund fing das Kind zu brabbeln an. Ihr stellten sich die Haare auf. Sie musste das Gespräch schnell beenden. Doch der Bärtige erzählte gerade umständlich, wie er in der zehnten Klasse wegen seiner abstehenden Ohren und seiner klugen Antworten gemobbt worden war. Die Frau heischte lautstark Mitleid und Bewunderung, um das Brabbeln zu übertönen. Dann stellte sie sich stumm und nickte nur mit weit aufgerissenen Augen, als der Mann berichtete, wie Klassenkameraden ihn damals in die Mülltonne stopften. Jetzt wollte er von ihr wissen, ob sie Geschwister habe. Das Kind fing gerade an zu greinen. Die Frau wagte nicht, die Stummschaltung aufzuheben. Sie mimte Zeitdruck, indem sie auf ihre Uhr zeigte. Der Mann runzelte die Stirn, lächelte aber weiter freundlich. Die Frau winkte ihm ein hastiges „Tschüs!“ und klickte ihn weg. Der Bildschirm wurde schwarz.
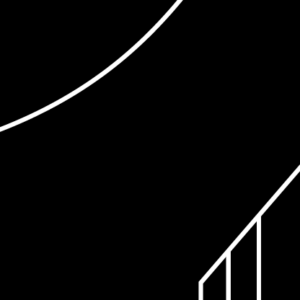
Währenddessen fuhr die Vorarbeiterin aus der Kartonfabrik mit ihrer jüngeren Kollegin auf deren Mofa durch die Nacht. Sie wollte die Betrunkene sicher nach Hause bringen. Die Jüngere klammerte sich an den Rücken der Fahrerin. Als die Betrunkene sich übergeben musste, hielten sie an. Danach griff die Jüngere die Vorarbeiterin an. Sie fragte, wieso sie sich das einfach gefallen ließen? Sie hätten immer gut gearbeitet, es sei nicht fair, sie einfach auf die Straße zu setzen. Sie finde bestimmt keinen neuen Job. Die Vorarbeiterin versuchte, sie zu beruhigen, ihr zu versichern, dass alles gut werde. Doch die Jüngere glaubte ihr nicht, sie vermutete sogar, dass die Ältere den Mund hielt, weil sie gar nicht auf der Straße stehen würde. Hatte sie eine Abmachung mit den Besitzern? Hatten sie ihr eine neue Stelle versprochen? Die Vorarbeiterin widersprach, konnte die andere aber nicht überzeugen. Als sie merkte, dass Reden nichts half, wendete sie das Mofa. Die Jüngere war verblüfft, stieg aber auf. Die Vorarbeiterin verfolgte keinen bestimmten Plan, sie hatte nur das unbestimmte Gefühl, dass sie Dampf ablassen sollten, schon damit sie selbst nicht vor ihren Kolleginnen das Gesicht verlor. Weil sie bei ihrer Chefin bereits den Rasen gemäht hatte, wusste sie, wo deren Einfamilienhaus lag. Die Jüngere schien nicht überrascht, als die Vorarbeiterin ihr erklärte, wer hier wohnte. Sie klingelten. Die Rhododendren blühten im Vorgarten. Ein steinerner Frosch spie Wasser in eine Vogeltränke aus Ton. Doch im Haus blieb alles ruhig. Niemand öffnete ihnen. Sie versuchten es wieder und wieder, klingelten Sturm. Es war schon spät. Die Besitzer der Firma mussten eigentlich schon im Bett liegen. Schließlich schlichen die beiden Frauen um das Haus herum, in den Garten. Und tatsächlich sahen sie durch das Panoramafenster im Wohnzimmer das blaue Licht des Fernsehers flimmern. Die Chefin döste auf dem Sofa davor. Die Arbeiterinnen im Garten standen still. Sie hätten Steine ins Fenster werfen können. Oder zumindest schreien. Sie taten nichts davon. Sie starrten durch die Fensterscheibe. Und sie fühlten, dass sie hier an der falschen Adresse waren. Die Chefin lag da wie ein Ballon, aus dem die Luft entwichen war. Der Schlaf entspannte ihr Gesicht nicht, sondern es war ihr verrutscht. Ihre Lefzen hingen herab. Ein Speichelfaden spann sich von ihren Mundwinkeln aus gen Boden. Diese Frau war erledigt, so wie sie selbst, von ihr war keine Rettung zu erwarten. Die Frauen sprachen kein Wort. Sie drehten um, legten sich schlafen und kehrten am nächsten Tag an ihre Arbeitsplätze zurück, arbeiteten weiter und wussten selbst nicht genau, warum.
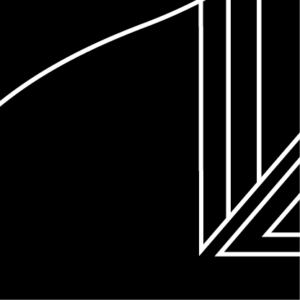
Abends verließen die Kartonarbeiterinnen die Fabrik, die Näherin ihre Maschine, die Fahrerin parkte ihren Wagen und die Klickarbeiterin fuhr ihren Computer herunter. Ich glaube, sie stiegen alle in den gleichen Bus. Er trug sie an der langen Betonwand entlang, hinter und vor ihnen saßen weitere Arbeiterinnen. Sie blickten in den weißen, wolkenverhangenen Himmel, sahen die Regentropfen vom Wind gepeitscht an der Scheibe entlang rinnen und wie ein Flugzeug startete in der Ferne. Seine Nase erschien über den Baumwipfeln am Waldrand. Das Rauschen der Turbinen schwoll endlos an und irgendwo im Atlantischen Ozean landete die Raumkapsel mit den vier Weltraumtouristen, getragen von vier Fallschirmen. Die Frauen im Bus aber fuhren bis zur Endstation. Am Wendehammer blieben sie sitzen und warteten darauf, dass die Reise in die andere Richtung begann.